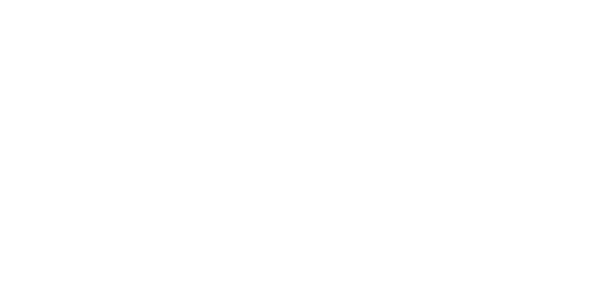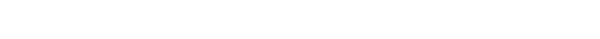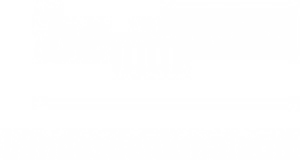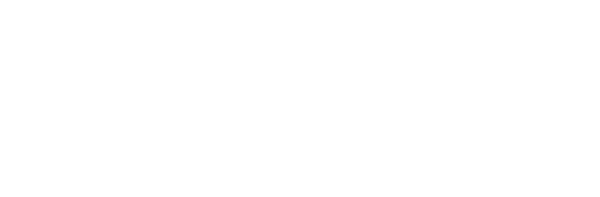Baugebundene Kunst (8)
Das freistehende, viergeschossige Gebäude über quadratischem Grundriss ist im Stil der italienischen Renaissance errichtet. Nord- und Südfassade haben jeweils sieben Achsen und sind durch einen vorspringenden Mittelrisalit gegliedert. An der Nordfassade befindet sich der Haupteingang, der durch eine Treppenanlage mit Portikus besonders hervorgehoben ist. Die Ost- und Westfassaden sind durch acht Achsen gegliedert.
Das Sockelgeschoss ist mit belgischem Granit verkleidet. Das erste und zweite Obergeschoss sind als Hauptgeschosse durch Verblendungen aus gleichmäßig angeordneten, horizontalen Streifen aus hell- und dunkelroten Klinkern gestalterisch zusammengefasst. Große dreiteilige Fenster in den Ausstellungsetagen prägen die Fassaden des Ausstellungsgebäudes, die im zweiten Obergeschoss mit flachen Dreiecksgiebeln überdacht sind. Drei umlaufende Schmuckfriese trennen die Obergeschosse voneinander. Den oberen Abschluss bildet ein weit vorkragendes Kranzgesims aus Terrakotta (Nicola Vösgen).
Fakten
Kategorie
Epoche
Werkdaten
Schaffende/
Gropius, Martin (Architekt:in)
1877-1881
Schmieden, Heino (Architekt:in)
Kampmann, Winnetou (Architekt:in der Rekonstruktion)
ab 1978, Wiederaufbau
Hilmer & Sattler Architekten (Architekt:in)
ab 1998, Umbau- und Sanierung
Datierungshinweise
1978: Wiederaufbau
Objektgeschichte
Das Gebäude wurde 1877-81 nach Entwürfen der Architekten Martin Gropius (1824-1880) und Heino Schmieden (1835-1913) als Kunstgewerbemuseum errichtet, die Einweihung fand am 21. November 1881 statt. Die Anregung zum Bau des Museums kam von dem bereits 1867 gegründeten Verein Deutsches Gewerbemuseum, zu dessen Mitgliedern auch Gropius zählte. In dem Gebäude waren neben dem Museum auch die Sammlung und die Bibliothek des Museums sowie die Kunstgewerbeschule untergebracht. Seit 1922 nutzten das Museum für Vor- und Frühgeschichte sowie die Ostasiatische Kunstsammlung das Gebäude, die Kunstgewerbeschule war in ein östlich nebenbei errichtetes Bauwerk umgezogen. Nach erheblichen Kriegszerstörungen und jahrelanger Verwahrlosung begann 1978 der Wiederaufbau unter Leitung des Architekten Winnetou Kampmann und seiner Ehefrau Ute Weström. Da sich das Museumsgebäude direkt an der Berliner Mauer befand, musste der Zugang an die südliche Rückseite verlegt werden. Nach dem Mauerfall und der deutschen Wiedervereinigung erfolgten seit 1998 durch das Architekturbüro Hilmer und Sattler umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, dabei wurde auch die ursprüngliche Eingangssituation an der Nordseite rekonstruiert. Im Jahr 1999 konnte das Museum wiedereröffnet werden. Seit 2001 betreiben die Berliner Festspiele im Auftrag der Bundesregierung für Kultur und Medien den Gropius Bau (Nicola Vösgen).
Zitierhinweis/Referenzen
- Kampmann, Winnetou : Martin-Gropius-Bau. Die Geschichte seiner Wiederherstellung, München, 1999.
- Berlin und seine Bauten V A, Bauten für die Kunst, Berlin, 1983, S. 54.
- Berlin und seine Bauten, Teil I, Berlin, 1877, S. 19ff.
- Berlin und seine Bauten, Der Hochbau, Berlin, 1896, S. 223ff.
- Beier, Rosemarie: Der Martin-Gropius-Bau. Geschichte und Gegenwart des ehemaligen Kunstgewerbemuseums, Berlin, 1986.
- Licht, Hugo: Architektur Deutschlands, Übersicht der hervorragendsten Bauausführungen der Neuzeit, Bd. 2, 1882, S. 15 Taf. 192f.
- Das Kunstgewerbemuseum zu Berlin, Festschrift zur Eröffnung des Museumsgebäudes, Berlin, 1881.
Wenn Sie einzelne Inhalte von dieser Website verwenden möchten, zitieren Sie bitte wie folgt: Autor*in des Beitrages, Werktitel, URL, Datum des Abrufes.