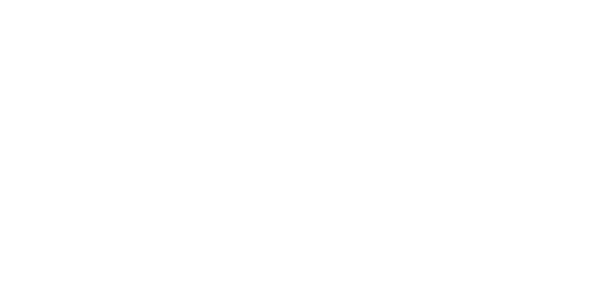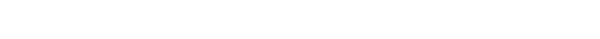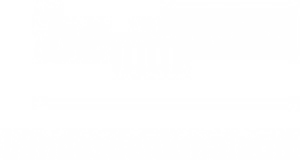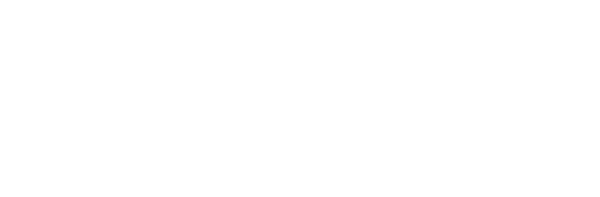Baugebundene Kunst (7)
Die Hauptfront des Theaters des Westens liegt an der Kantstraße. Das Erdgeschoss hat eine Sandstein-Rustika, sechs Eingänge führen in das Innere. Darüber folgen sieben über zwei Geschosse reichende Rundbogenfenster zwischen Dreiviertelsäulen auf hohen Konsolen. Vor der Fensterreihe verläuft ein schmaler Balkon mit Balusterbrüstung. Auf dem Gebälk ist die Inschrift zu lesen: „HANC DOMVM ARTIS COLENDAE CAVSA CONDIDIT / Anno MDCCCLXXXXVI Bernhard Sehring.“ (lat.: Dieses Haus gründete Bernhard Sehring im Jahr 1896, um die Kunst zu pflegen). Die Gebäudeecken aus geschlossenem Mauerwerk sind leicht vorgezogen und enden in Kuppelaufsätzen. Die Attika ist mit sechs Putten geschmückt, in der Mitte steht eine kolossale Bronzegruppe.
Die westliche Schmalseite ist mit Dreiviertelsäulen gegliedert und schließt mit einem Dreiecksgiebel ab. Die sog. „Kaisertreppe“ führt zu dem westlichen Gebäudeeingang (Nicola Vösgen).
Fakten
Standort
Epoche
Werkdaten
Schaffende/
Sehring, Bernhard (Architekt:in)
1895-1896
Objektgeschichte
Mit den Bauarbeiten auf dem zuvor als Lagerplatz der Bollerei Bolle genutzten Geländes wurde im Oktober 1895 begonnen. Für die Planungen verantwortlich war der Theaterarchitekt Bernhard Sehring, der das Theater anfangs auch selbst betrieb. Am 01. Oktober 1896 eröffnete das Theater mit einer Aufführung von Holger Drachmanns Märchenschauspiel „Tausendundeine Nacht“. Nach eher geringen Beschädigungen im II. Weltkrieg wurde das Theater in den 1950er Jahren wiederhergestellt. Eine umfassende Restaurierung der Fassaden erfolgte anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins in den 1980er Jahren. Am 24. September 2002 beschloss der Berliner Senat den Verkauf des Theater des Westens an den niederländischen Musical-Konzern Stage Entertainment, seit 2011 lautet der Name „Stage Theater des Westens“. Verloren sind vier von Hans Dammann entworfene Figuren, Poesie und Musik symbolisierend, die sich auf der Spitze der vier Dachlaternen befanden (Nicola Vösgen).
Zitierhinweis/Referenzen
- Berndt, Ralph: Bernhard Sehring. Ein Privatarchitekt und Theaterbaumeister des Wilhelminischen Zeitalters. Leben und Werk., Cottbus, 1998, S. 162ff.. (teilweise mit unzutreffenden Bildhauerzuschreibungen und Werkbezeichnungen)
- Berlin und seine Bauten V A, Bauten für die Kunst, Berlin, 1983, S. 110.
- Inventar Charlottenburg (Bau- und Kunstdenkmale von Berlin, Bez. Charlottenburg), Berlin, 1961, S. 203ff.
- Berlin und seine Bauten, Der Hochbau, Berlin, 1896, S. 507.
- Die Kunst-Halle 1, 1895/1896, S. 153f.
- Zentralblatt der Bauverwaltung, 16.1896, 1896, S. 453ff.
Wenn Sie einzelne Inhalte von dieser Website verwenden möchten, zitieren Sie bitte wie folgt: Autor*in des Beitrages, Werktitel, URL, Datum des Abrufes.