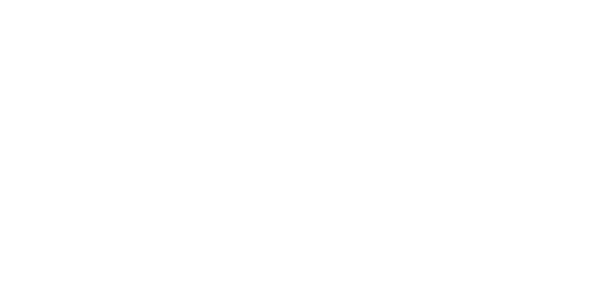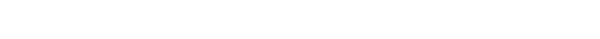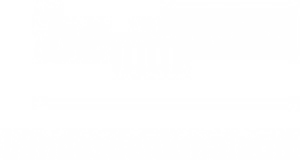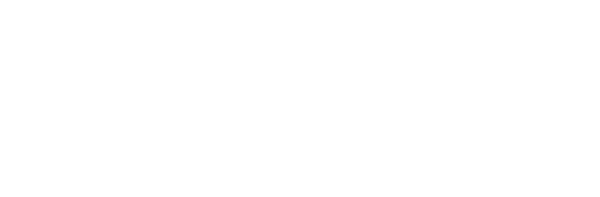Oberhalb der Erdgeschossfenster verläuft an beiden Fassaden ein Band mit dunkelgrün glasierten Formsteinen und dazwischen gesetzten Medaillons mit farbig glasierten männlichen und weiblichen Köpfen. An der Goltzstraße sind es vier männliche, nach links blickende Köpfe mit Turban und zwei unterschiedliche weibliche Köpfe mit Haarband und Trauben bzw. mit Diadem, an der Fassade zur Hohenstaufenstraße befinden sich drei weitere Köpfe: ein männlicher Kopf mit Turban und zwei sehr ähnliche Frauenköpfe mit Haarband (Nicola Vösgen).
Fakten
Standort
Kategorie
Epoche
Werkdaten
Schaffende/
Lessing, Otto (Bildhauer:in)
1893, Modelle für drei der Medaillons (Zuschreibung)
Ernst March & Söhne Tonwarenfabrik (Ausführende:r)
Ausführung drei der Medaillons (Zuschreibung)
Datierungshinweise
Vermutung Modelle (für drei der Medaillons))
1894-1895 (Vermutung: teilweise Wiederverwendung am Gebäude in der Goltzstraße (für drei der Medaillons); um Mitte 20. Jahrhundert (Vermutung Nachschöpfung (für sechs der Medaillons)
Objektgeschichte
Es ist nicht überliefert, wer für die Fassadengestaltung mit den farbig glasierten Terrakotten verantwortlich war. Interessanterweise hatten vergleichbare Terrakotten bereits an dem 10 Jahre zuvor errichteten Interimsbau des Café Helms Verwendung gefunden. Das Café Helms war direkt gegenüber vom Berliner Schloss auf der Schloßfreiheit / Straße an der Stechbahn nach Plänen von Hermann Ende und Wilhelm Böckmann erbaut worden. Der Restaurationsbetrieb wurde am 23.09.1883 eröffnet. Das Gebäude bestand aus zwei Pavillons, die durch eine lange Halle verbunden waren. Bereits zum Zeitpunkt der Erbauung war absehbar, dass dieser Standort nur temporär nutzbar war, deshalb hatten die Architekten eine Eisenfachwerkkonstruktion verwendet, die für eine spätere Wiederverwendung konzipiert war. Die Fassaden des Café Helms waren reich mit farbigen Terrakottareliefs verziert. U.a. das Zentralblatt der Bauverwaltung berichtete über den Neubau an prominenter Stelle. Ausführlich beschrieben wurden auch die Fassaden, die aus „farbigen Terracotten aus der Fabrik von Ernst March Söhne in Charlottenburg nach Modellen des Bildhauers Otto Lessing gefertigt [waren]. Es ist hierbei der Versuch gemacht worden, den gebrannten Thon im Sinne der italienischen Renaissance polychrom zu behandeln, jedoch nur wenige ungebrochene Farbtöne anzuwenden. Die Medaillons zwischen den Balustern stellen sinnbildlich den Wein, das Bier, den Thee, den Kaffee und den Tabak dar, theils durch Figuren allgemein bekannter Ueberlieferung, wie Bacchus und Gambrinus, theils durch Bevölkerungstypen der verschiedenen Länder, welchen diese Genußmittel entstammen.“ In einem um 1888 veröffentlichten Verkaufskatalog der Firma March sind sechs Medaillons abgebildet, die vermutlich denjenigen an den Fassaden des Café Helms entsprechen. Das Café wurde bereits 10 Jahre nach der Inbetriebnahme im Winter 1893/1894 in Zusammenhang mit der Errichtung des Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals abgebrochen. Bereits von 1990 stammt die Vermutung des Architekturhistorikers Peter Lemberg, dass die Terrakotten des Café Helms gerettet und möglicherweise an dem Schöneberger Mietshaus in der Goltzstraße wiederverwendet wurden (Wolf, March, S. 190, Anm. 485). Die Abbildungen in dem March-Katalog weisen tatsächlich eine große Übereinstimmung mit den Schöneberger Medaillons auf. Allerdings können die an dem Gebäude in der Goltzstraße vorhandenen neun Medaillons nicht vollständig vom Café Helms stammen. Am Café Helms waren die Stirnseiten und die beiden zur Stechbahn gelegenen Risalite der Pavillons mit in Dreigruppen angeordneten Medaillons verziert, d.h. es gab dort insgesamt 12 Medaillons. Anhand von Fotos gut dokumentiert sind nur zwei dieser Dreiergruppen: die an der in Richtung Schloss gelegenen östlichen Stirnseite und das westliche Risalit an der Stechbahn. Diese waren mit identischen Medaillons verziert, den Darstellungen eines „Chinesen“, eines weiblichen Kopfes mit Diadem und einem „M*“. Da in dem Zentralblatt fünf Medaillons beschrieben und in den Verkaufskatalog von Moritz Geiss insgesamt sechs Medaillons abgebildet waren, liegt die Vermutung nahe, dass an dem An der Stechbahn östlich gelegenen und an der Fassade in Richtung Werderscher Markt die anderen drei Medaillontypen, ein Mann mit Turban, eine Frau mit Trauben (Bacchus) und ein Gambrinus angebracht waren. Somit war am Café Helms jedes Motiv nur in zwei Exemplaren vorhanden und auf den ersten Blick erscheint es somit ausgeschlossen, dass es sich zumindest bei den fünf Medaillons des nach links blickenden „Mann mit Turban“ an der Goltzstraße um die Medaillons von der abgebauten Fassade des Cafe Helms handeln könnte. Betrachtet man jedoch die neun Medaillons genauer, fällt auf, dass sich diese stilistisch stark voneinander unterschieden. So sind bei den insgesamt fünf Köpfen des „Mann mit Turban“ Bart und Gesichtsformen in vier Fällen sehr grob formuliert, nur der dritte Kopf (v.l.) an der Goltzstraße weist eine detaillierte Ausformung der Gesichtszüge, des Bartes sowie auch des Turbans auf. Dasselbe gilt für den weiblichen Frauenkopf mit Trauben, den Bacchus. Auch hier ist ein Exemplar, das zweite (v.l.) in der Goltzstraße, deutlich detailreicher ausgeführt als die anderen beiden Medaillons gleichen Typs. Weiterhin fällt auf, dass bei den beiden beschriebenen, detaillierter ausgearbeiteten Medaillons, auch der Goldgrund eine dezentere Farbigkeit aufweist, diese Farbigkeit findet sich auch bei dem nur einmal vorhandenen Medaillon der Frau mit Diadem. Denkbar wäre folgende Interpretation: Die beschriebenen drei Medaillons könnten tatsächlich von der Fassade des 1893 abgerissenen Café Helms stammen, wobei der Architekt dann sicherlich alle neun Medaillons von dort übernommen hätte. Möglicherweise waren diese Terrakotta-Arbeiten zu einem unbekannten Zeitpunkt, vermutlich nach dem Zweiten Weltkrieg, zu einem großen Teil zerstört und nach zwei der verbliebenen Medaillons (Mann mit Turban und Bacchus) sind in der Nachkriegszeit relativ freie Nachschöpfungen geschaffen worden (Nicola Vösgen).
Verwendete Materialien
Technik
geformt
gebrannt
farbig gefasst, glasiert
Zustand
Vollständigkeit
Zitierhinweis/Referenzen
- Wolf, Christine: Studien zur Tonwarenfabrik March in Charlottenburg, Berlin, 1990, S. 190.
- Zentralblatt der Bauverwaltung, 16.1896, 1896, S. 375.
- Ausgeführte Backsteinbauten der Gegenwart, Bd. 1, Berlin, 1891, S. 14, Taf. 90.
- Licht, Hugo: Architektur der Gegenwart: Übersicht der hervorragendsten Bauausführungen der Neuzeit, Bd. 1, 1890, S. 15, Taf. 59ff.
- Ernst March's Thonwaaren-Fabrik, Charlottenburg bei Berlin: Sammlung photographischer Abbildungen von Vasen, Kandelabern, Fontänen, Taufsteinen, Statuen, Bauornamenten usw., Bd. 5, Berlin, 1888, S. Taf 100, E 292-297.
- Zentralblatt der Bauverwaltung, 4.1884, Nr. 1, 1884, S. 4f.
Wenn Sie einzelne Inhalte von dieser Website verwenden möchten, zitieren Sie bitte wie folgt: Autor*in des Beitrages, Werktitel, URL, Datum des Abrufes.